|
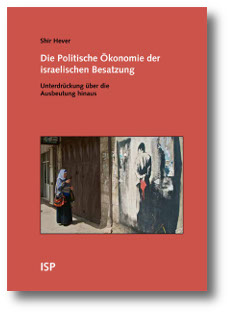 Shir
Hever Shir
Hever
„Die Politische Ökonomie der israelischen Besatzung.
Unterdrückung über
die Ausbeutung hinaus“
ISP-Verlag Köln, 2014. ISBN 978–3–89900-140-2
Rezension von Ekkehart Drost, 7.11.2014
Zu den
entschiedensten Aktivisten gegen die Besatzung gehört der
35jährige, in Jerusalem geborene, israelische
Wirtschaftswissenschaftler Shir Hever. Er ist
Mitglied des Alternative Information Center in Beit
Sahour, das im Jahr 1984 als eine der ältesten Nahost-NGOs
von palästinensischen und israelischen
Graswurzelorganisationen gegründet wurde. Zur Zeit
promoviert er über das Thema „Privatisierung der
israelischen Sicherheit“. Hever gilt als Experte in Fragen
der
„Political
Economy of Israel's Occupation“,
wie der Titel seines Buches lautet, das seit seinem
Erscheinen im Jahr 2010 zu einem Standardwerk geworden ist.
Viele Gruppen und Organisationen im deutschsprachigen Raum
schätzen ihn als kompetenten Vortragsredner zu den Themen
Militärischer Komplex, „Boykott, Desinvestitionen und
Sanktionen“ (BDS) und Wirtschaft.
Hever
setzt sich eingangs kritisch mit dem auch von ihm (aus
praktischen Gründen) verwendeten Begriff „Besatzung“
auseinander: Dieser suggeriere einen vorüber gehenden
Status. Tatsächlich aber müsse man von einem einzigen Staat
Israel/Palästina ausgehen, ein Territorium, das sich über
das ganze, von der israelischen Armee kontrollierte Gebiet
erstreckt. Allerdings führen die besonders prekären
Lebensverhältnisse der Menschen in den Besetzten Gebieten
dazu, dass man von „zwei Ökonomien“ sprechen müsse, die
unter israelischer Kontrolle koexistieren.
Hart
geht Hever mit der Rolle der Palästinensischen
Autonomiebehörde (PA) beim wirtschaftlichen Aufbau nach der
Zweiten Intifada ins Gericht. Die PA gründete und gründet
sich auf Günstlingswirtschaft, internationale Unterstützung
und israelische Manipulation. Sie war nicht in der Lage, die
verheerende materielle Situation der palästinensischen
Bevölkerung zu verbessern – im Gegenteil: „Die Modalitäten
ihres politischen Überlebens zwangen die PA häufig, im
Einvernehmen mit der israelischen Besatzungsmacht zu
handeln.“ (S. 30) Neve Gordon bezeichnete diese Politik
sogar als „Outsourcen der Besatzung“.
Den
in diesem Zusammenhang oft erhobenen Korruptionsvorwurf
gegen die PA begegnet Hever sehr viel differenzierter. Er
verweist auf diesbezügliche Studien der Weltbank, der OECD
sowie letztlich auf den Bericht von Transparency
International aus dem Jahr 2005, bei dem Palästina den 107.
Platz von 158 untersuchten Staaten einnimmt. Dennoch
fiel dieser Vorwurf auch innerhalb der palästinensischen
Bevölkerung auf fruchtbaren Boden: Der Sieg der Hamas bei
den Wahlen von 2006 wird darauf zurückgeführt. Die bekannte
heftige und undemokratische Reaktion der USA/EU auf dieses
Wahlergebnis führte trotz der Versicherung der Fatah, in
Zukunft für Transparenz zu sorgen, dazu, dass Geldsendungen
an die Hamas auf undurchsichtigen Wegen, zum Teil in Koffern
mit Bargeld über den Grenzübergang Rafah, weitergeleitet
wurden. Darüber hinaus gingen Hilfsgelder für
Infrastrukturmaßnahmen vor allem an internationale NGOs,
während der PA diese Gelder entzogen wurden.
Die
Arbeit der NGOs sowie die finanzielle Unterstützung durch
das Ausland werden seit längerer Zeit kontrovers diskutiert.
Entgegen den Tatsachen wird immer wieder behauptet, die
palästinensische Bevölkerung erhalte die höchste
Entwicklungshilfe pro Kopf. Tatsächlich steht Israel an
erster Stelle, die Besetzten Gebiete hingegen erst auf Platz
20. Shir Hever setzt sich in diesem Zusammenhang unter
anderem mit Nancy Fraser auseinander. Deren Meinung nach sei
trotz kurzfristiger positiver Effekte keine nachhaltige
Verbesserung der sozioökonomischen Situation zu beobachten.
Die Hilfe führe eher zu einer Verlängerung der Besatzung
und diene letztlich israelischen Interessen. Hevers
überzeugende Antwort: „Entwicklungshilfe (...) dient auch
dazu, die Verzweiflung in Grenzen zu halten und
palästinensischen Aktivisten die Chance zu geben, ihre
gewaltfreien Optionen des Kampfes gegen die Besatzung zu
überprüfen.“ (S. 59)
Wer
bezahlt die Kosten der Besatzung, wer profitiert von ihr?
fragt Hever. Die Antwort auf die erste Frage lautet:
Grundsätzlich und zum größten Teil durch Steuern der
israelischen Bürger; darüber hinaus von der Zionistischen
Weltorganisation sowie von der staatlichen Lotterie. Es gibt
aber noch zwei weitere Gruppen, die an der Finanzierung
beteiligt sind: Es sind einmal die Palästinenser durch
Ausbeutung des palästinensischen Marktes seitens
israelischer Unternehmen als auch die verschiedenen Formen
von Einkommen, die Israel auf Kosten der Palästinenser
zufließen. Zum anderen sind es US-Bürger, deren Steuern dazu
verwendet werden, „Israels militärische Bestrebungen zu
fördern“; diese Ausgaben wurden zur größten US-Hilfe
weltweit.
Auch
die Antwort auf die Frage nach den Profiteuren fällt sehr
differenziert und überlegt aus – ein Merkmal, das die
gesamte Arbeit auszeichnet. Es gibt eben auch hier keine
einfachen und schon gar keine plumpen Antworten. So werden
in der öffentlichen Diskussion häufig „die Siedler“ genannt,
was nur zum Teil zutrifft, in keinem Fall aber auf die
Siedlungen, die zur Gemeindeverwaltung Jerusalems gehören.
Und die Profite von Unternehmen innerhalb der Besetzten
Gebiete lassen sich schlecht verifizieren – sie werden
zumeist so verschleiert, dass sie nicht nachprüfbar sind.
Mit
Sicherheit aber lässt sich sagen, dass die „Homeland
Security“-Industrie und israelische Militärunternehmen zu
den großen Profiteuren gehören. In Yotam Feldmans Film „The
Lab“ wird dieser Umstand eindrucksvoll dokumentiert.
Shir
Hever stellt am Ende dieses Kapitels fest, dass die Lasten
der Unterdrückung erste Auswirkungen auf den Wohlstand und
das Lebensgefühl der Israelis zeigen. Ein Indiz ist sicher
die große Zahl junger, gut ausgebildeter Israelis, die vor
den immensen Lebenshaltungskosten in Israel regelrecht
Zuflucht in Berlin suchen. In einem großen Artikel in der
Süddeutschen Zeitung im Oktober 2014 wurde die Zahl von
30000 (!) Israelis genannt. Die Reaktion in den israelischen
Medien auf diese „Landflucht“ fiel entsprechend heftig und
negativ aus. Hever weist darauf hin, dass der soziale
Zusammenhalt in der israelischen Gesellschaft , in der
„nationale und ethnische Unterscheidungen wichtiger sind als
Klassenidentität, sehr schwach ausgeprägt“ (S. 124) ist.
Zudem werden die Ursachen der zunehmenden Verarmung großer
Teile der israelischen Gesellschaft nicht mit den Folgen der
Besatzung in Verbindung gebracht, was besonders deutlich
während der „Zelt-Demonstrationen“ in Tel Aviv und anderen
Großstädten im Sommer 2011 deutlich wurde.
Eine
Rezension muss sich aus unterschiedlichen Gründen auf
ausgewählte Abschnitte beschränken. Bei Shir Hevers
fundierter Analyse fällt das nicht leicht; weitere wichtige
Kapitel können daher nur stichwortartig genannt werden. So
schreibt er über Trends der israelischen Wirtschaft, stellt
eine Fallstudie über die Auswirkungen der Mauer vor, geht in
einem theoretisch fundierten Kapitel über die Implikationen
der Besatzung ein und nennt sein Schlusskapitel eine
„Theoretische Analyse und Zweistaatlichkeit“.
Shir
Hever hat in vielen Gesprächen mit dem Rezensenten die
globale Bedeutung des israelisch-palästinensischen
Konfliktes betont: als „Laboratorium, wo ziviler Widerstand
der hoch entwickelten Maschinerie der Kontrolle
gegenübersteht und wo Menschenmassen aufragenden Betonmauern
gegenüberstehen. Der Ausgang dieses Konfliktes wird nicht
nur die Zukunft dieser Region, sondern die Gestalt
zukünftiger Konflikte und Besatzungen in der ganzen Welt
bestimmen.“ (S. 236)
Die
Lektüre der „Politischen Ökonomie der israelischen
Besatzung“ ist für jeden, der intensiver nach den Gründen
für die seit Jahrzehnten andauernde Besatzung sucht,
unabdingbar. Die hervorragende Übersetzung durch die beiden
Aktivistinnen Heidi Niggemann und Angelica Seyfried
erleichtert den Zugang zu diesem schwierigen, aber umso
wichtigeren Thema. Hever schreibt dazu: „Betrachtet man,
wie einerseits die Besatzungsbedingungen durch massive
internationale Finanzmittel beeinflusst werden oder wie sich
das tägliche Leben in Israel/Palästina durch die Trennmauer
verändert, dann wird sichtbar, dass wirtschaftliche
Bestrebungen nicht weniger Auswirkungen auf die Natur des
Konflikts haben, als militärische Operationen. Nur durch das
Verständnis dieser Formen von wirtschaftlichen Beziehungen
lässt sich der Konflikt überhaupt entwirren.“
Und am
Schluss heißt es: „Dieses Buch wurde mit dem klaren Ziel
geschrieben, der Propaganda entgegenzuwirken, die von den
israelischen und pro-israelischen Regierungen und Medien
verbreitet wird. Es erfüllt seinen Sinn, wenn es einen
kleinen Beitrag dazu leistet: Das Ende der Besatzung, des
jüdischen Staates und der Gewalt und anstelle des
bestehenden Systems der Repression die Schaffung eines
demokratischen Staates, in dem alle, die in dem derzeit von
Israel kontrollierten Gebiet leben, repräsentiert werden.“
(S. 236) |